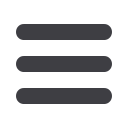

1 2017
Esslinger Gesundheitsmagazin 25
Weichteilbrüche sollten in der Regel operiert werden, denn
sie bilden sich nicht mehr zurück und haben die Tendenz, grö-
ßer zu werden und Beschwerden zu verursachen. Wird heute
ein Bruch diagnostiziert, entscheiden die Mediziner zusam-
men mit dem Patienten, welche Art der Operation sinnvoll ist.
„Es wird zwischen offenen und minimalinvasiven Operationen,
der sogenannten Schlüsselloch-Operation, unterschieden.
Sofern es der Gesundheitszustand und die Krankengeschichte
des Patienten erlauben, wird minimalinvasiv operiert“, sagt
Professor Staib. Offene Ope-
rationen werden meist nur
dann angewandt, wenn im
Bauchraum erhebliche Ver-
wachsungen des Gewebes
oder der Organe vorliegen.
Was beide Vorgehensweisen
eint, ist der Einsatz von Net-
zen, um den Bruch zu ver-
schließen. Das sogenannte
Verfahren nach Lichtenstein
wird bei offenen Operatio-
nen angewendet und ist seit
langem Standard. Vorteil
die s er Methode is t die
vergleichsweise niedrige
Schmerzempfindlichkeit
nach dem Eingriff.
Die Netze werden vom Chi-
rurgen auf die Bruchpforte
gelegt und mit dem Bauch-
fell vernäht. Zu allergischen Reaktionen oder Abstoßungen
kommt es in der Regel nicht. „Was aber nach dem Einsetzen
des Netzes immer wieder vorkommen kann, ist eine soge-
nannte Wundwasserbildung (Serom). Das ist aber eine natür-
liche Reaktion des Körpers, denn es wird ein Fremdkörper in
den Organismus eingebracht. Mit der Zeit bildet sich das
Gewebswasser zurück.
Kaum Risiken zu erwarten
Netze gibt es in unterschiedlichen Formen. Neben dem klas-
sischen, viereckigen oder ovalen Netz gibt es auch Leisten-
bruch-Netze in anatomisch gerechter 3D-Form, die sich der
Bruchpforte gut anpassen. Für kleine Nabelbrüche gibt es
ringverstärkte Spezialnetze. Sie bestehen aus einem kleinen
Tellerchen, an dem eine Schlaufe befestigt ist. Dieses Teller-
chen ist groß genug, um den Bruch zu verschließen. Kommt
es beim Patienten künftig zu Druckaufbau durch Husten oder
Bauchpresse, wird der Druck im Inneren dank des Tellerchens
breitflächig verteilt und die gebrochene Stelle bleibt stabil
verschlossen. Bei einer minimalinvasiven Operation wird in
Narkose durch einen kleinen Bauchdecken-Schnitt zunächst
die Bauchhöhle mit CO2 druckkontrolliert aufgefüllt. Über
weitere kleine Schnitte werden eine Minikamera und die Ope-
rationsinstrumente in die Bauchhöhle eingeführt. Die Bilder
der Kamera werden dem Operateur auf Bildschirmen ange-
zeigt, so dass er die Instrumente problemlos steuern kann.
„Dabei können wir inzwischen auf die Video-3D-Technologie
zurückgreifen. Das OP-Team trägt dazu 3D-Brillen, man kann
es sich also vorstellen wie im Kino. So erlangen wir einen
guten Überblick, wie der Bruch aussieht und wie wir ihn sta-
bil versorgen können“, berichtet der Professor. Für den Pati-
enten ist das Verfahren sehr schonend.
„Unsere operativen
Methoden sind inzwi
schen so perfektioniert,
dass durch relativ
wenig Aufwand und mit
geringem Risiko eine
Hernie gut behandelt
werden kann.“
Klinikum Esslingen
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Professor Dr. Ludger Staib
Telefon 0711-3103-2601
l.staib@klinikum-esslingen.deRisiken bestehen bei beiden Operationsvarianten kaum mehr.
Die Verfahren sind inzwischen jahrelang erprobter und
bewährter Standard. In manchen Fällen sind dennoch Kompli-
kationen nicht auszuschließen, über die der Patient vor der
Operation ausführlich aufgeklärt wird. „Es ist möglich, dass es
zu einem Rezidiv, also einer Wiederkehr des Bruches, kommt.
Auch kann es vorkommen, dass der Patient noch eine Weile
unter Leistenschmerzen leidet, die ernst genommen, abgeklärt
und behandelt werden müssen“, ergänzt Professor Staib.
Untersuchungen durch das
Klinikum Esslingen haben
aber ergeben, dass nur bei
knapp neun Pr ozent der
Patienten nach Abschluss
der Behandlung chronische
Schmer zen auf treten. In
lediglich sieben Prozent der
Fälle kam es zu einem Rezi-
div. Im Umkehrschluss heißt
das, dass die große Mehrheit
der Patienten mit einem Leis-
tenbruch nach dem Eingriff
wieder beschwerdefrei die
gewohnten Alltagstätigkeiten
verrichten kann. Wichtig ist
jedoch, dass der Patient die
Anweisungen des Arztes nach
der Operation genau befolgt.
Wer beispielsweise zu früh
mit schwerer körperlicher
Arbeit beginnt, erhöht das
Risiko auf ein Rezidiv.
Jeder kann von einem Bruch betroffen sein. Vorbeugende Mög-
lichkeiten gibt es nicht. „Menschen, die unter starkem Über-
gewicht oder extrem schwachem Bindegewebe leiden, sind
jedoch häufiger betroffen“, so Professor Staib.
fw
Während der Operation tragen die Chirurgen 3D-Brillen











