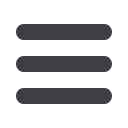
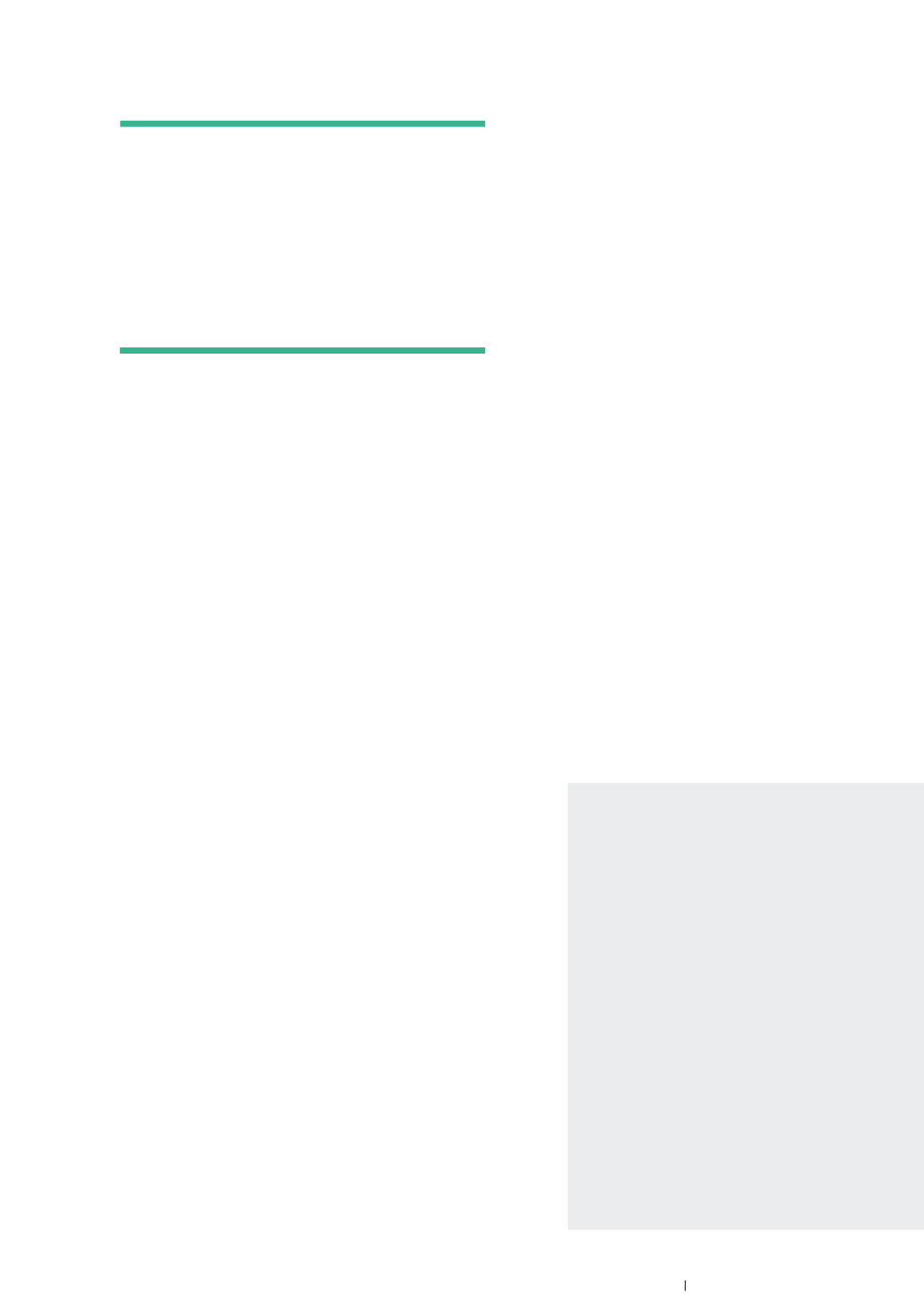
1 2016
Esslinger Gesundheitsmagazin 35
Woran erkennt man
eine gute Studie?
Wenn man ein Krankenhaus gefunden hat, das
medizinische Studien durchführt, sollte der
Patient auf drei Punkte achten:
• Wie viele Studien werden für die jeweilige
Erkrankungen angeboten?
• Nimmt das Krankenhaus regelmäßig an
Studien teil? Denn je mehr Erfahrung die
Ärzte mit Studien haben, desto besser ist
in der Regel die Behandlung.
• Wie viele Publikationen haben die Ärzte
veröffentlicht? Wie stark sind sie wissen-
schaftlich aktiv?
All diese Informationen sollten auf der Home-
page der Klinik zu finden sein.
>>>
Wissenschaftler sind an Fortschritt interessiert und treiben ihn
voran. Professor Dr. Michael Geißler, Chefarzt der Klinik für All-
gemeine Innere Medizin, Onkologie/Hämatologie, Gastroente-
rologie und Infektiologie am Klinikum Esslingen, ist so ein Wis-
senschaftler. Der Mediziner initiiert deshalb immer mehr
sogenannte IIT-Studien. „Das besondere an diesen Studien ist,
dass der Wissenschaftler eine Idee hat und deshalb eine Studie
startet“, sagt Professor Geißler. Anders als bei Medikamenten-
studien, die von Pharmafirmen gemacht werden, ist der Wissen-
schaftler nicht von ökonomischen Interessen geleitet.
Ärzte, die eine IIT-Studie initiieren, sind häufig Mitglied in wis-
senschaftlichen Gremien und Organisationen, haben für ihr
Fachgebiet die medizinischen Leitlinien mitverfasst und besitzen
ein großes wissenschaftliches Renommee. Neben Professor
Geißler sind das am Klinikum Esslingen auch Professor Dr. Mat-
thias Leschke, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und
Pneumologie, und Professor Dr. Thorsten Kühn, Chefarzt der
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Die Fachgesellschaften prüfen die
Qualität einer Studie
Bevor aus einer Idee eine wissenschaftliche Studie werden kann,
sind einige Hürden zu nehmen. Zunächst wird die Idee erst ein-
mal in den Gremien der Wissenschaftsorganisationen diskutiert.
Im Fall von Professor Geißler sind das die Deutsche Krebsge-
sellschaft (DKG) und die Arbeitsgemeinschaft Internistische
Onkologie (AIO). „Es ist ein gutes Zeichen, wenn die wissen-
schaftlichen Mitglieder der Fachorganisationen, z.B. die Leit-
gruppe Darmkrebs der AIO sich entschließt, die Studie zu unter-
stützen“, sagt der Onkologe. Nicht nur um eine Finanzierung
der Studie zu erlangen. Denn ein AIO-Label als Zeichen der
Unterstützung der Fachgesellschaft ist ein Zeichen für die hohe
wissenschaftliche Qualität der Fragestellungen, die in der Stu-
die untersucht werden soll, aber natürlich auch für die beson-
dere Reputation des Mediziners. So wie Erkenntnisse über
Brustkrebs, die Professor Kühn vor einigen Jahren in einer Stu-
die mit 1.100 Teilnehmerinnen gewonnen hat. „Noch vor 15
Jahren wurden bei einer Brustkrebs-OP alle Lymphknoten aus
den Achselhöhlen entfernt“, sagt der Gynäkologe. In der Studie
konnte gezeigt werden, dass ein operativer Eingriff genauso
wirkungsvoll ist, wenn man nur die sogenannten Wächter-
lymphknoten, anstelle aller Lymphknoten, entfernt.
Ärzte wollen Leben retten und suchen
immer neue Wege, um ihre Patienten zu
heilen. Medizinische Studien sind dabei
ein wichtiger Beitrag. Bei ihrer Forschung
müssen sich die Ärzte an gesetzliche Vor
gaben halten – der Schutz des Patienten
ist oberstes Gebot.
In Studien können verschiedene Operationsmethoden vergli-
chen, aber auch neue Medikamente gegen die standardisierten
Mittel getestet werden. „Wir nennen das randomisierte-Pla-
cebo-kontrollierte-Studien“, sagt Professor Geißler. Die Patien-
ten werden dabei zufällig in die zwei verschiedenen Gruppen
eingeteilt. In der Fachsprache nennt man das Randomisierung.
Beispielsweise erhält der eine Patient die Standardtherapie plus
das neue Medikament, während andere die Standardmedika-
tion und eine Scheinmedikation, ein sogenanntes Placebo,
bekommen. „Keiner der Patienten weiß, in welcher Gruppe er
ist“. Wichtig ist, dass die Ziele der Studie vor Beginn klar defi-
niert sind und eine statistische Hypothese vorliegt, also z. B.
das Ziel einer Verbesserung des Gesamtüberlebens um 25 Pro-
zent und eine Verbesserung der Lebensqualität durch ein neues
Medikament.
Wer eine klinische Studie durchführen möchte, bewegt sich im
Rahmen von gesetzlichen Vorschriften, die den Patienten schüt-
zen sollen. Jede kontrollierte Studie in Deutschland muss vom
Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) oder
vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) genehmigt werden. Beide Behör-
den unterstehen dem Bundesgesundheitsministerium. „Wird in
der Studie Strahlentherapie eingesetzt, entscheidet auch das
Bundestrahlenschutzamt mit“, ergänzt Professor Geißler. Um
die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, dürfen in Studien
nur Medikamente eingesetzt werden, die sich zuvor im Labor
und in Krankheitsmodellen bewährt haben. Ein zusätzlicher Bau-
stein der Patientensicherheit ist die GCP. GCP ist die Abkürzung
für Good Clinical Practice (zu Deutsch: „gute klinische Praxis“)
und bezeichnet international anerkannte, nach ethischen und
wissenschaftlichen Gesichtspunkten aufgestellt Regeln für die
Durchführung von Studien.
Gesetzlich vorgeschrieben ist zudem auch, dass für jede Studie
die Zustimmung einer Ethikkommission eingeholt werden muss.
„Die Ethikkommission prüft, ob der Nutzen für den



















