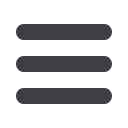
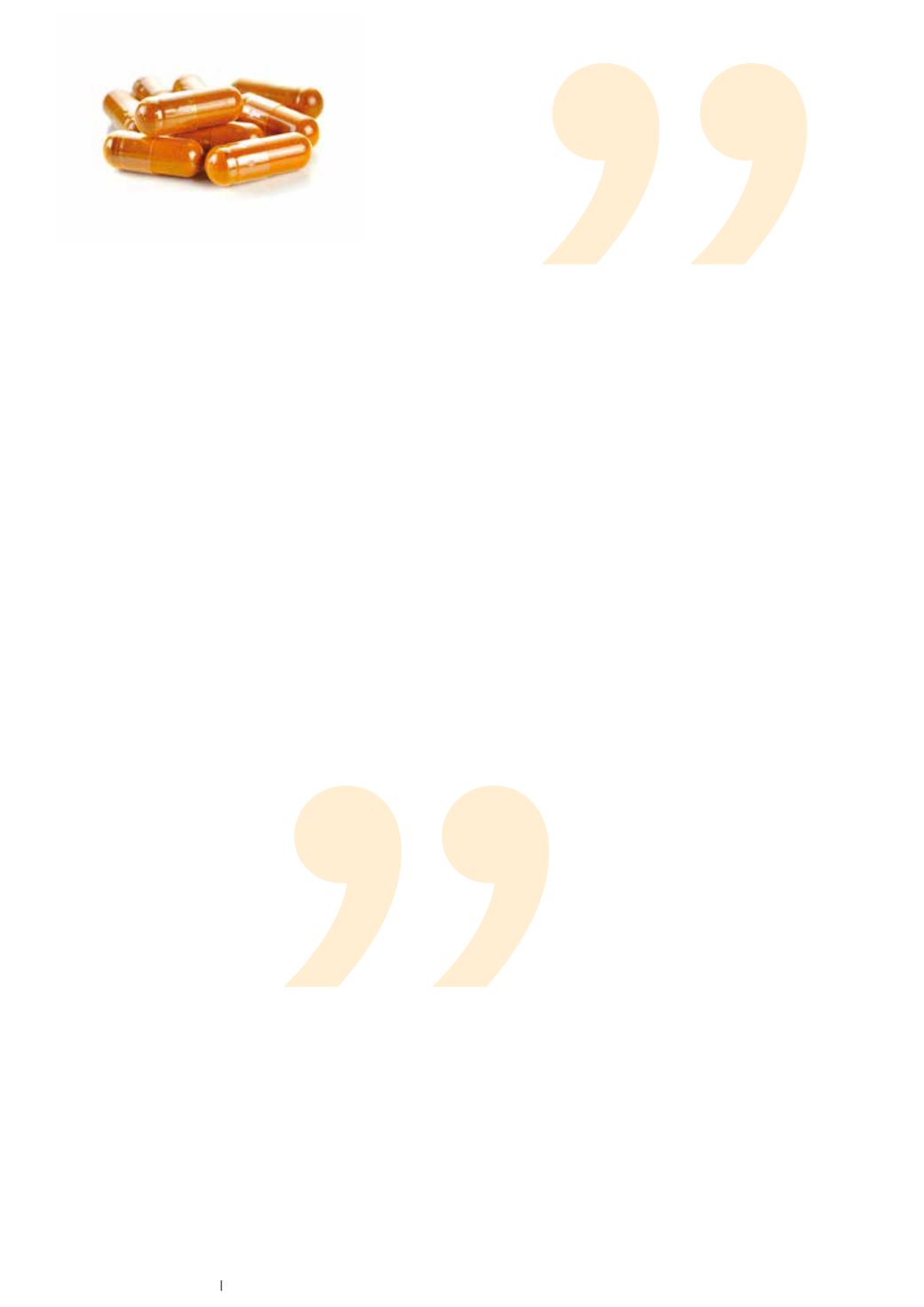
36 Esslinger Gesundheitsmagazin
1 2016
Patienten ein mögliches Risiko überwiegt“, sagt Professor
Geißler. Sein Kollege Professor Matthias Leschke arbeitet seit
mehr als zehn Jahren in der Ethikkommission der Nordwürt-
tembergischen Ärztekammer: „Eine Ethikkommission achtet
genau auf die ethischen Aspekte, die Zuverlässigkeit und Durch-
führbarkeit, auf mögliche Risiken und den zu erwartenden Nut-
zen. Eine Studie darf nur durchgeführt werden, wenn von Sei-
ten der Ethikkommission keine Bedenken vorliegen.“
Sicherheit an erster Stelle
Die Maßstäbe, um eine Studie durchführen zu können, sind in
Deutschland sehr hoch, das dient der Patientensicherheit. „Der
hohe bürokratische Aufwand lässt die Kosten jedoch schon vor
der eigentlichen klinischen Arbeit immens in die Höhe steigen.“
Deshalb ist es fast unmöglich, Studien ohne die finanzielle
Unterstützung der Pharmaindustrie zu verwirklichen. „Wir Wis-
senschaftler verlieren dadurch aber ein Stück Unabhängigkeit“,
kritisiert Professor Geißler.
Deswegen fordert der Esslinger Onkologe sowie viele andere
Mediziner, einen staatlichen, unabhängigen Fond nach US-
amerikanischem Vorbild zu gründen. Die Fördermittel der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und der Deutschen Krebshilfe
sind hier bei weitem nicht ausreichend. „Es gibt allein 80 ver-
schiedene Krebserkrankungen, für die in unterschiedlichen Sta-
dien verschiedene Behandlungsmethoden erforscht werden
müssen.“ Ohne eine ausreichende Finanzierung ist das aber nur
schwer möglich. „Damit ein Studienzentrum einigermaßen kos-
tendeckend arbeiten und die hohen Anforderungen an Qualität
und Dokumentation einer Studie erfüllen kann, sind Kosten pro
Studienpatient von 5.000 Euro und mehr notwendig. Dazu kom-
men pro Patient nochmals ca. 10.000 Euro, damit spezielle Ins-
titute die Studien betreuen und die Daten auswerten. Bei einer
Studie mit 1.000 Patienten laufen hier ohne Behördenkosten
ohne weiteres 15 Millionen Euro auf. Als börsennotierte Unter-
nehmen verfolgen Pharmafirmen bei der Unterstützung von
Medikamentenstudien ein klares ökonomisches Ziel. „Deshalb
ist das Interesse an Studien über die großen Volkskrankheiten
größer als bei seltenen Krankheiten“, sagt Professor Geißler. All
diese bürokratischen Hürden nehmen Zeit in Anspruch – bis zu
zwei Jahre von der Planung bis zum Start der Studie und Ein-
schluss des ersten Patienten. Neben dem Studienleiter und den
benannten Prüfärzten ist die Arbeit des Studiensekretariates
mit den Studienassistenten von großer Bedeutung. Im Studi-
enzentrum von Professor Geißler am Klinikum Esslingen küm-
mern sich zwei Studienassistentinnen um die Bürokratie und
die Dokumentation. „Sie entlasten uns Ärzte von der Bürokra-
tie und weisen uns zum Beispiel darauf hin, wann Blutwerte
untersucht werden müssen“, sagt Professor Geißler. „Es ist im
übrigen klar geregelt, dass nur die benannten und entsprechend
geschulten Ärzte die Patienten behandeln und aufklären dür-
fen“, erklärt Professor Geißler.
Je mehr Patienten an einer Studie teilnehmen, desto aussage-
kräftiger sind die Ergebnisse. Doch die Suche nach den passen-
den Patienten kann Zeit in Anspruch neh-
men. „Für 100 Patienten habe ich schon
mal dreieinhalb Jahre gesucht“, erzählt
Professor Geißler. Um genug Patienten zu
rekrutieren, sind weltweit immer mehrere
Zentren und Kliniken an einer Studie
beteiligt. „Fast 50 Studien laufen aktuell
am Klinikum Esslingen. Das ist vergleich-
bar mit einer Universitätsklinik“, sagt er.
Schwerpunkte liegen bei Lymphdrüsen-
krebs, Leukämien, Lungen-, Speiseröh-
ren-/Magen-, Darm-, Bauchspeicheldrü-
sen-, Brust- und Eierstockkrebs.
Unter anderem forscht Professor Geißler an der Immuntherapie
und zielgerichteten Substanzen zur Behandlung von Krebs. „Wir
wollen weg von der Chemotherapie, die auf den ganzen Körper
wirkt und hin zu einer gezielten Bekämpfung der Tumorzellen“,
erklärt Professor Geißler. Im Kampf gegen den Dickdarmkrebs
wird zum Beispiel versucht, das körpereigene Immunsystem
gegen den Tumor zu aktivieren. Eine weitere Studie vergleicht
neue Therapien mit Viren, Impfungen und Antikörpern gegen
Bauchspeicheldrüsenkrebs.
„Wir wollen weg von der Chemo-
therapie, die auf den ganzen
Körper wirkt und hin zu einer
gezielten Bekämpfung der
Tumorzellen.“
Gewusst?
Placebo
Placebos nennt man Scheinmedikamente,
die keine Wirkung haben. Sie werden in
klinischen Studien eingesetzt, um einen
Vergleich zu den getesteten Medikamen-
ten zu haben.
„Die Ethikkommission
prüft, ob der Nutzen
für den Patienten ein
mögliches Risiko über-
wiegt.“
>>>



















