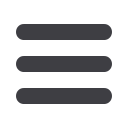

1 2017
Esslinger Gesundheitsmagazin 37
Folge von Demenz, Parkinson oder
Schlaganfällen auf. „Einteilen kann man
die Aphasie in vier Typen, die sich in der
Schwere unterscheiden. Bei einer amnes-
tischen Aphasie liegen Wortfindungsstö-
rungen vor. Bei der Broca-Aphasie kämpft
der Patient schon mit erheblicheren
Schwierigkeiten. Er muss sich zum Bei-
spiel mächtig anstrengen beim Sprechen“,
erklärt die Logopädin. Zu den beiden
schwersten Formen der Aphasie gehören
die Wernicke-Aphasie mit einem erheb-
lich gestörten Sprachverständnis und die
globale Aphasie. Sie macht Kommunika-
tion nur sehr schwer möglich.
Um aber genau zu wissen, an welcher
Form der Aphasie der Patient leidet, gibt
es verschiedene Testmöglichkeiten. „Ich
benutze als Test dazu oft die ACL (Apha-
sie-Check-Liste)“, sagt Andrea Dauben-
berger. Dabei prüft sie die Sprach- und
Merkfähigkeiten des Erkrankten. „Der
Patient muss zum Beispiel Reihen spre-
chen. Wir schauen also, ob er dieWochen-
tage korrekt aufzählen kann. Es wird aber
auch untersucht, ob der Patient in der
Lage ist, laut vorzulesen, nach Diktat zu
schreiben oder Gegenstände und Körper-
teile zu benennen.“ Auch Handlungswei-
sen wie „Klopfen Sie auf den Tisch“, wer-
den abgefragt. „Die ACL gibt uns eine
Orientierung, welche sprachlichen Defi-
zite bestehen. Davon hängt dann ab, wel-
che Therapie wir wählen und vor allem,
welche Ziele wir erreichen wollen“, sagt
Andrea Daubenberger. Die gesamte The-
rapie erfolgt grundsätzlich in enger
Abstimmung mit den Familien. „Die Ange-
hörigen wissen am besten, was dem
Betroffenen wichtig ist. Wenn sich ein
Patient vor seiner Erkrankung vor allem
durch Sprache definiert hat, beispiels-
weise Lehrer oder Journalist war, werden
Therapieziele anders gesteckt als bei
einem Patienten, der in seinem Beruf und
im Alltag weniger mit Sprache zu tun
hatte“, erklärt sie weiter. Generell gilt: Je
früher eine Therapie begonnen werden
kann, desto höher liegen die Chancen auf
Erfolg.
„Je früher eine Therapie
begonnen werden kann,
desto höher liegen die
Chancen auf Erfolg.“
Daher findet man die Logopädin mit
ihrem Team heute auch vor allem in der
Neurologischen Abteilung. Aber auch
Patienten in anderen Abteilungen können
die Unterstützung des Logopädie-Teams
in Anspruch nehmen. „Pro Tag behandeln
wir im Durchschnitt 20 bis 25 Patienten.
Es hängt natürlich immer davon ab, wie
viele Menschen gerade auf den Stationen
sind“, erklärt sie. Aber nicht nur Menschen
mit neurologischen Erkrankungen bedür-
fen Frau Daubenbergers Hilfe. „Gerade
wenn ein Patient durch eine Tumorerkran-
kung am Kehlkopf beeinträchtigt ist,
braucht er logopädische Unterstützung.
Hier können häufig Dysphagien oder
Stimmstörungen vorliegen, die wir thera-
pieren müssen“, weiß sie.
fw
Andrea Daubenberger
Vom „Sprachheilkundler“
zum Logopäden
Ob eine Sprachtherapie erfolgreich ist,
hängt aber auch vom Schweregrad der
Erkrankung ab. „Manchen Patienten kann
man durchaus kleinere „Hausaufgaben“
geben. Gerade wenn ein Patient an einer
Sprechstörung (Dysarthrie) leidet, kann
er in der Regel Übungen zur Mund- und
Zungenmotorik selbstständig machen.“
Beispiele für Dysarthrien können extrem
verlangsamtes oder leises Sprechen, aber
auch das Verschlucken oder Umdrehen
von Lauten, sein.
Bevor Patienten aus der Klinik entlassen
werden, erhalten sie und ihre Angehöri-
gen Übungsmaterialien. „Häufig gehen
die Erkrankten im Anschluss direkt in eine
Reha. Dort werden sie weiter von Logo-
päden betreut. Es gibt aber auch die Mög-
lichkeit, sich nach der Entlassung logopä-
disch weiterhin durch das Klinikum
versorgen zu lassen.“ Entweder können
die Patienten in die logopädische Ambu-
lanz kommen oder aber sie lassen sich an
eine der eigenständigen Praxen in Esslin-
gen und Umgebung verweisen.
Der Beruf des Logopäden war in den letz-
ten 100 Jahren vielen Wandlungen unter-
zogen. Ist er inzwischen in weiten Teilen
akademisiert, war er zur Lehrzeit von
Andrea Daubenberger in einer dreijähri-
gen Ausbildung zu erlernen. Ende des 19.
Jahrhunderts wurden erstmals soge-
nannte „Sprachheilkundler“ in mehrtägi-
gen Schulungen ausgebildet. Berufsziel
war es, Kinder die an einer Sprachstörung
litten, zu therapieren. Anfang des 20.
Jahrhundert schuf der österreichische
Mediziner Emil Fröschels den Begriff der
Logopädie, die Sprachheilkunde wurde ab
dann Teil des Studiums der Psychologie.
„Seit den 80er Jahren ist die Logopädie,
wie wir sie heute kennen, Teil der Neuro-
logie. Bis dahin war Sprachtherapie vor
allem im Bereich der Inneren Medizin
angesiedelt“, so ordnet Andrea Dauben-
berger ihren Beruf in einen historischen
Kontext ein.
Gewusst?
Sprach
fähigkeiten
Das Wernicke-Areal ist Teil des
oberen Schläfenlappens. Ist es
geschädigt, sind Störungen der
Sprachrezeptoren die Folge.
Seinen Namen hat das Wernicke-
Areal vom deutschen Arzt Carl
Wernicke. Der erforschte 1874
Verluste der Sprachfähigkeit.
Therapieabteilung Logopädie
Teamleiterin Andrea Daubenberger
Telefon 0711 3103-2491
a.daubenberger@klinikum-esslingen.deBroca
Wernicke











