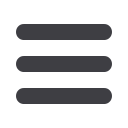
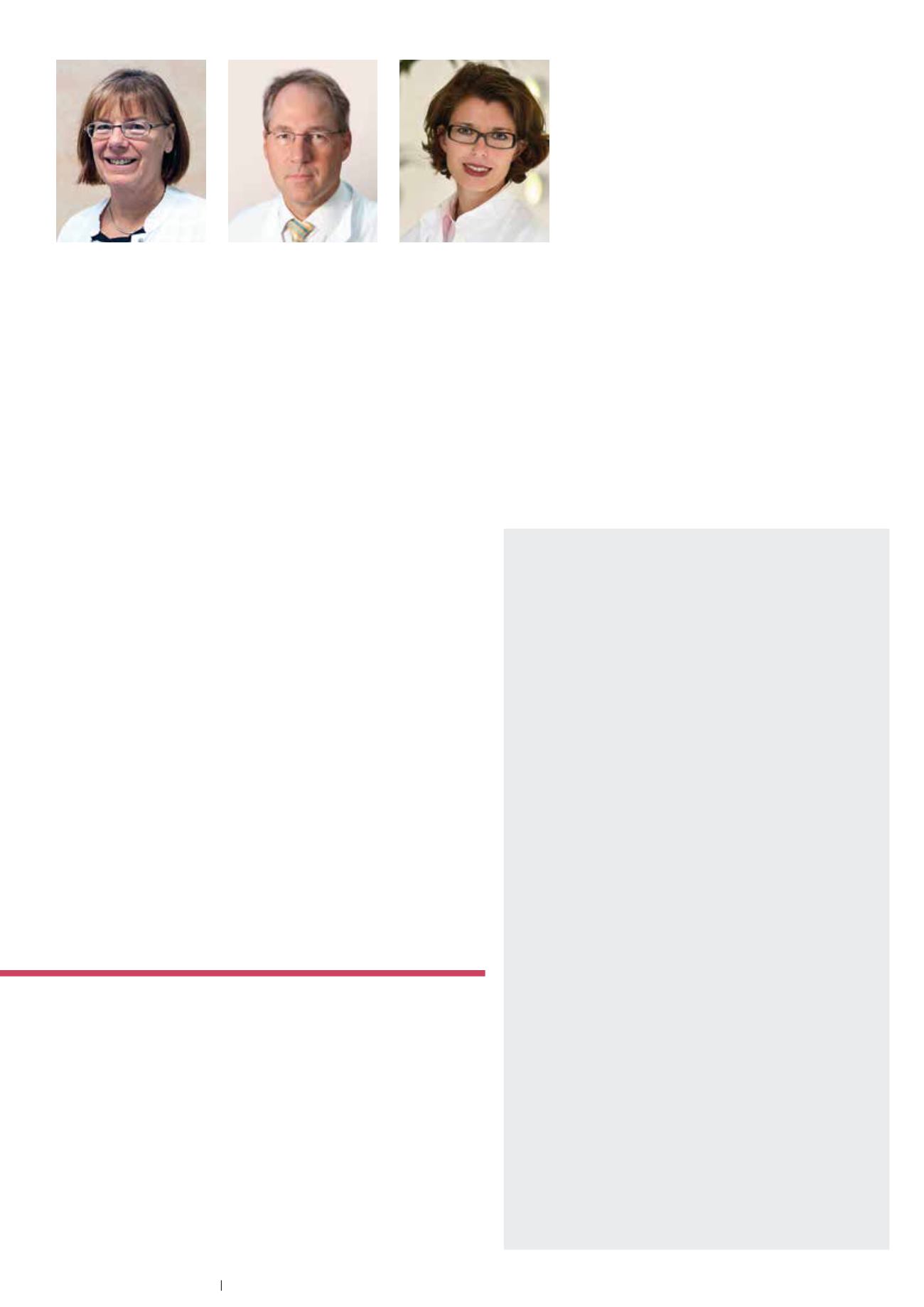
10 Esslinger Gesundheitsmagazin
2 2015
Auch bei der Radiojodtherapie macht man sich wieder den Effekt
zunutze, dass nur aktive Schilddrüsenzellen Jod speichern.
Radioaktiv strahlende Teilchen werden für die Therapie an Jod-
moleküle angedockt. Die Herstellung ist kompliziert und wird
nur in wenigen Speziallabors durchgeführt, von denen es in
Deutschland nur ein einziges in Braunschweig gibt. Für jeden
Patienten bestellt Dr. Zimmer dort die individuell nötige Dosis.
Da die Strahlung mit der Zeit immer geringer wird, muss bei der
Dosisberechnung auch die Transportzeit eingerechnet werden,
so dass die Therapie mit der exakt geplanten Strahlenintensität
beginnen kann.
Die Patienten schlucken das Therapiemittel in Form einer Kap-
sel. Das Jod mit dem radioaktiven Teilchen Huckepack wandert
zur Schilddrüse und wird dort aufgenommen. Die sogenannte
Beta-Strahlung des radioaktiven Teilchens zerstört dann inner-
halb von Tagen die Schilddrüsenzelle. „Mit einer Reichweite von
nur 0,44 bis 2,2 Millimetern ist die Wirkung der Beta-Strahlung
sehr effektiv und begrenzt auf das Schilddrüsengewebe“, erläu-
tert Dr. Zimmer. Allerdings hat das Teilchen auch eine Gamma-
Strahlung, die nach außen dringt. „Die Halbwertzeit der Gam-
mastrahlung beträgt acht Tage, deshalb müssen die Patienten
zwischen zwei und sechs Tagen auf der Station verbringen.“
Jeden Tag wird am Patienten mit einem Geigenzähler gemes-
sen, wieviel Strahlung noch messbar ist. Weil die strahlenden
Teilchen vor allem über den Urin ausgeschieden werden, verfügt
die nuklearmedizinische Station über vier jeweils 20.000 Liter
fassende Abklingtanks. In denen werden alle Abwasser der Sta-
tion gesammelt. Ist ein Tank voll, dauert es etwa drei Monate
bis alle Radioaktivität aus dem gesammelten Abwasser ver-
schwunden ist. Dieser Tank kann dann in die Kanalisation ent-
leert werden. Die Patienten selbst spüren durch die Radiojod-
therapie in aller Regel keine Nebenwirkungen. „Da mit Be-
seitigung einer Überfunktion die Schilddrüse durch die Behand-
>>>
Klinikum Esslingen
Klinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie
und Nuklearmedizin
Bereich Nuklearmedizin/MVZ
Leitende Oberärztin:
Dr. Petra Zimmer
Telefon 0711 3103-3380
p.zimmer@klinikum-esslingen.deKlinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Chefarzt:
Prof. Dr. Ludger Staib
Telefon 0711 3103-2611
l.staib@klinikum-esslingen.deInternistische Privatpraxis
Dr. med. Jasmin Greilich
Kollwitzstraße 16
73728 Esslingen
Telefon: 0711 6 64 66 59
dr.greilich@internist-esslingen.deDr. Petra Zimmer
Prof. Dr. Ludger Staib
Dr. Jasmin Greilic
Autoimmunerkrankungen:
Wenn der Körper sich gegen
sich selbst richtet
Als Morbus Basedow und Hashimoto werden zwei spe-
zielle Schilddrüsenerkrankungen bezeichnet, bei denen
sich das Immunsystem unseres Körpers gegen die
Schilddrüsenzellen wendet. Sie werden deshalb auch
als Autoimmunerkrankung bezeichnet.
Die Hashimoto-Thyreoiditis, wie die Erkrankung medi-
zinisch korrekt heißt, ist nach dem japanischen Arzt
Hakaru Hashimoto benannt, der das Krankheitsbild
1912 erstmals beschrieben hat. Sie ist heute eine der
häufigsten Autoimmunerkrankungen und die häufigste
Ursache für eine primäre Schilddrüsenunterfunktion.
Die Erkrankung führt zu einer chronischen Entzündung
der Schilddrüse mit Zerstörung der hormonproduzie-
renden Zellen und damit zu einer Unterfunktion. Die
Hashimoto-Erkrankung ist derzeit nicht heilbar, verläuft
aber meist mit nur geringen Beschwerden. Die Unter-
funktion wird durch Hormongabe behandelt.
Auch Morbus Basedow ist nach dem Erstbeschreiber
Carl Adolph von Basedow (1840) benannt. Die Autoim-
munerkrankung äußert sich häufig mit einer Überfunk-
tion der Schilddrüse, manchmal auch mit einem Kropf
und den typischen Symptomen einer Überfunktion. In
20 bis 30 Prozent sind die Augen beteiligt, die stark her-
vortreten und vielfach als Basedowsche Augen bezeich-
net werden. In einigen Fällen kommt die Erkrankung mit
Medikamenten nach mehreren Monaten selbst zum
Stillstand, kann aber jederzeit erneut auftreten. Meist
ist daher eine Operation der Schilddrüse oder eine
Radiojodtherapie erforderlich.
lung gleichzeitig auch verkleinert wird, kann es zu
einer teils gewünschten Unterfunktion kommen, die
dann mit einer Schilddrüsenhormongabe behandelt
wird“, erklärt Dr. Zimmer.
Nachsorge
Nach einer Schilddrüsenoperation oder einer Radio-
jodtherapie übernimmt der Hausarzt oder ein nieder-
gelassener Internist meist die Nachsorge. Dabei geht
es vor allem darum, mit einer individuellen Einstel-
lung der regelmäßigen Hormongabe die in der Regel
nach der Operation bestehende Unterfunktion aus-
zugleichen. „Zu mir kommen die Patienten meist am
siebten Tag nach der Operation“, erläutert Internistin
Dr. Greilich. Nachblutungen oder andere Komplika-
tionen habe sie dabei bislang nicht gesehen. Viele
Patienten klagen nach der Operation allerdings über
eine leichte Heiserkeit, was durch die Reizung der
Stimmbänder während der Operation begründet ist.
„In den meisten Fällen ist das nach vier bis sechs
Wochen abgeklungen. Wenn nicht, hilft eine
anschließende Therapie bei einem Logopäden.“
so



















